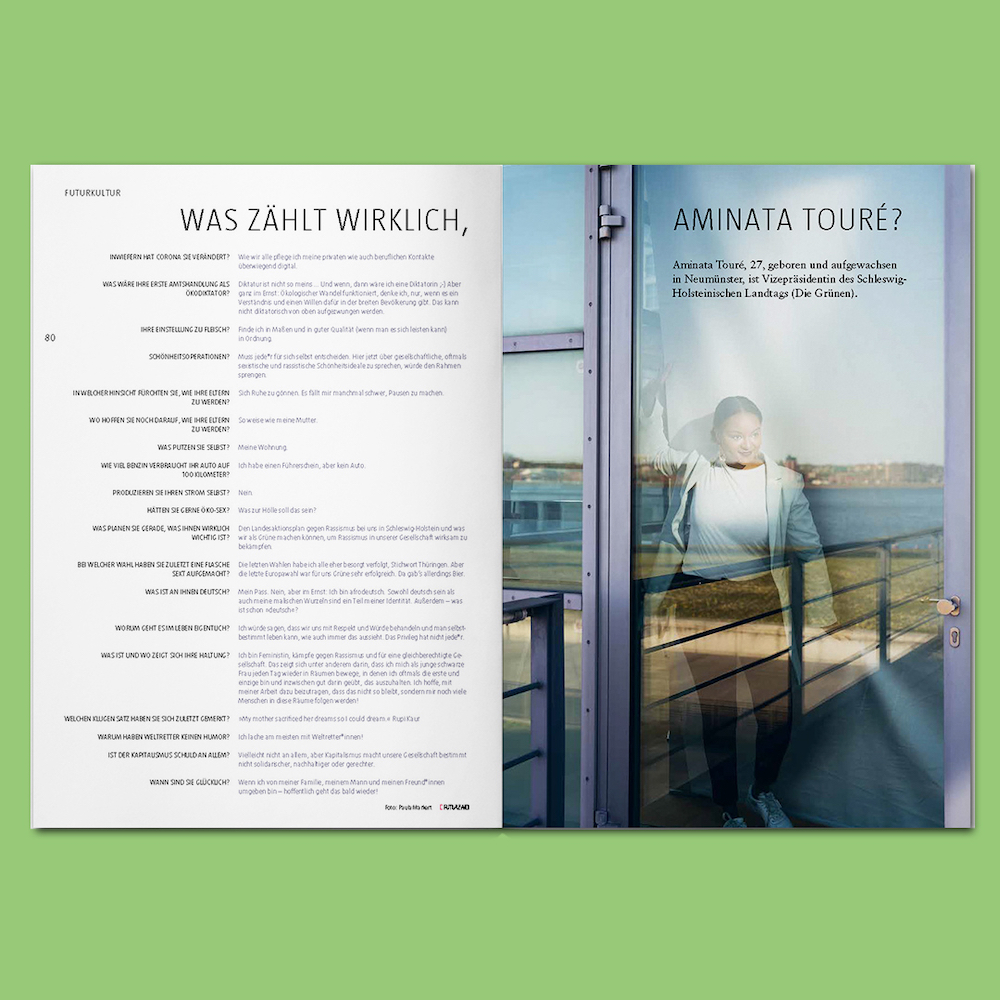Tobias Laukemper
Tobias Laukemper arbeitet als freier Bildredakteur aktuell in Hamburg, wo er für die Wochenzeitung DIE ZEIT tätig ist. Laukemper hat an dem Piet Zwart Institute in Rotterdam Bildende Kunst mit den Schwerpunkten Fotografie und Konzeptkunst und an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig Fotografie studiert. Wir sprechen über das gute Bild und seine katalytische Wirkung und darüber, welche Herausforderungen in der Redaktion entstehen, Bilder und Texte zusammenzubringen.
VTph Visual Thoughts: Tobias, du arbeitest als freier Bildredakteur, kommst aus der bildenden Kunst und hast an der Ostkreuzschule für Fotografie die Bildredaktionsklasse abgeschlossen. Vor deiner aktuellen Station bei der Wochenzeitung DIE ZEIT warst du auch für brand eins, die GEO und für verschiedene andere Editorialkunden tätig. Was macht deine aktuelle Arbeit aus und wie ist es für dich, Text und Bild zusammenzubringen?
Tobias Laukemper: Wenn man redaktionell arbeitet, ist der Text Auslöser und Ausgangspunkt für etwas, was später im Layout entworfen oder bildredaktionell editiert wird. Es ist wichtig herauszufinden, wie sich der Text bestmöglich visualisieren lässt. Natürlich lese ich den Text, bevor ich einen Auftrag vergebe. Das ist Teil meiner Arbeit als Bildredakteur. Ich überlege mir sehr genau, wer könnte mit diesem Text gut umgehen und das entsprechende Bildmaterial dazu liefern? Wie könnte der Fotograf oder die Fotografin diesen Text entsprechend in ein Bild einfließen lassen, wer kann gut damit arbeiten und begreift den Text als Inspiration und als Quelle?
Wenn du die Fotografen und Fotografinnen folglich entsendest, lesen sie sich den Text im Umkehrschluss ebenso durch, oder bekommen sie nur ein kurzes Briefing von dir?
Das ist sehr unterschiedlich und von Redaktion zu Redaktion verschieden. Wenn der Text vor der Drucklegung herausgegeben wird, vereinbart man eine Vertraulichkeit und der Fotograf kann ihn als inspirative Quelle nutzen. Er oder sie setzt ein Thema gemäß der eigenen Handschrift um und alle Beteiligten vertrauen darauf, dass es gerade durch den Text eine interessante visuelle Umsetzungen findet. Der Bildredakteur – in diesem Fall ich – gibt nicht immer konkret vor, was geschehen, oder auf dem Bild zu sehen sein soll, sondern stellt den Rahmen des Auftrags bereit.
Du arbeitest mit sehr vielen unterschiedlichen Fotografen und Fotografinnen – von aufstrebenden Künstlern bis hin zu großen Namen und arrivierten Größen in der Fotografie. Journalist und Fotograf begegnen sich aber dennoch auf einer Ebene und auf Augenhöhe?
Absolut. Und das ist, wie im täglichen Leben auch, immer wieder mit vielen Herausforderungen verbunden. Ich habe einen eigenen Anspruch und möchte erkennen: Was ist interessant für andere, aktuell und kann ich diese Erkenntnis für mich in Worte fassen? Wo ist mein eigener Standpunkt und wie korrelieren Dinge zwischen Ausführendem, der Redaktion und der Bildauswahl? Was mag ich, und was mag ich vielleicht auch einmal nicht – wie gehe ich damit um?
Das sind viele Fragen, die du dir selbst stellst. Gibt es für dich auch eine bestimmte Neutralität zu der Person, die die Bildstrecke produziert? Bleibst du neutral, wenn dich mal eine Arbeit nicht begeistert?
In den Redaktionen kontaktieren wir die Fotografen vorher, mit denen wir arbeiten möchten. Doch kann es natürlich passieren, dass die Bilder den eigenen Erwartungen nicht entsprechen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dem zu begegnen. Einerseits sollte man sich ständig selbst überprüfen – schauen, dass die eigene Offenheit erhalten bleibt, um so den Ergebnissen neutral gegenübertreten zu können. Manchmal steht jedoch auch der Fotograf als Bildproduzent seiner eigenen Arbeit vielleicht zu nahe, sodass ich als Feedback fungieren kann. Wir sprechen dann über einen weiteren Weg und schlagen vielleicht Optionen vor, die wir erkennen und veröffentlichen möchten.
Wie geht ihr mit den Eitelkeiten der Menschen um, die die Fotografen und Fotografinnen für euch portraitieren?
Dadurch dass die entstandenen Bilder öffentlich verwendet werden, ergeben sich Situationen, in denen nach der optimalen Darstellung gesucht wird. Manchmal sind die Meinungen darüber, welches Bild das Beste ist, sehr unterschiedlich. Von Fall zu Fall wird nach einem Fototermin von den Portraitierten selbst oder der Presseabteilung eines Unternehmens nach den entstandenen Bildern gefragt und um Zusendung zur Freigabe gebeten. Das ist verständlich, entspricht jedoch nicht dem journalistischen Ethos. Wir möchten die Unabhängigkeit bewahren und lehnen solche Anfragen dementsprechend ab. Die Auswahl der Bilder soll daher in unseren Augen eine eigenständige qualitative Stringenz haben, damit so eine ausdrucksstarke Arbeit möglich ist.
Wie alle anderen Branchen sind auch die Verlage dem Transformationsprozess unterworfen. Die Frage ist hier, was geht online, was bleibt offline?
Die Umstrukturierung unserer Arbeitswelt in das Informationszeitalter geht an den Magazinen und Verlagen nicht spurlos vorbei. Die Auflagen sinken. Wie begegnet man dieser Herausforderung? Wie kann man seine Inhalte auch noch anders präsentieren, die Marke, die man etabliert hat, anders zeigen oder weiter fassen? Ich habe mit der brand eins, mit der GEO und jetzt mit der Wochenzeitung DIE ZEIT sehr viel Glück gehabt, mit Redaktionen zu arbeiten, die großen Wert auf visuelle Qualität legen. Der Fokus liegt auf der ungewöhnlichen und qualitativ hochwertigen Umsetzung. Die Fotografie wird als zeitgenössisches Medium gesehen und es entstehen Bilder und Gestaltungen, die experimentieren und die Grenzen des Mediums austesten. Als Bildredakteur bin ich sehr dankbar, wenn ich so arbeiten darf.
Gemeinsam mit Anna Charlotte Schmid hattest du im Jahr 2014 den Fototreff Berlin gegründet. Welche Ideen standen hinter diesem Projekt und welche Ziele hatte ihr verfolgt?
Der Fototreff Berlin war ein Herzensprojekt. Zusammen mit Anna Charlotte Schmid bin ich gestartet, später kamen aber auch weitere Teammitglieder dazu. Jeder brachte durch seine Unterschiedlichkeit einen Teil mit ein. Im Laufe der Zeit hatte sich dann auch der Fokus etwas verändert. Anfänglich positionierten wir uns über die dokumentarische Fotografie und erst später kamen künstlerische Positionen in der Fotografie dazu. Drei Säulen machen das Programm aus. Wir haben die Reportage, die dokumentarische und die künstlerische Fotografie in den Fokus gesetzt. Inzwischen liegt die Schnittmenge nicht mehr zwischen Reportage und dokumentarischer Fotografie, sondern zwischen dokumentarischer und künstlerischer Fotografie.
Fehlte euch ein Forum in Berlin, sodass ihr selbst gründen wolltet?
Unser Ursprungsgedanke war, die eigene Arbeit mit anderen Kollegen teilen zu wollen, um aus diesen Gesprächen wiederum Anregungen für die eigene Arbeit zu erhalten. Das Besprechen, der Diskurs, findet auf Augenhöhe statt, das ist etwas, was uns von Anfang an ganz wichtig war. Wir haben versucht, für alle Karrierestufen und Unterschiedlichkeiten in der Bildsprache Platz zu schaffen. Verschiedene Künstler und Künstlerinnen haben eine gänzlich unterschiedliche Handschrift und aus dieser Position heraus haben sie auch viel von sich zu erzählen. Der Abend mit der Fotografin Loredana Nemes und dem Fotografen Peter Bialobrzeski im letzten Jahr war ein sehr gutes Beispiel dafür, dass zwei arrivierte Persönlichkeiten neugierig aufeinander sind und sich gegenseitig über ihre Unterschiedlichkeit herausgefordert haben. Das sind wirklich Glücksfälle – wenn der Saal voll ist und die Gäste noch über den Fluren Schlange stehen – und es freut uns als Veranstalter natürlich sehr. Inzwischen habe ich im Juli 2020 nach 6 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit den Fototreff Berlin verlassen, um mich neuen Tätigkeitsfeldern zuzuwenden.
Du hast ja viele Jahre selbst künstlerisch gearbeitet und parallel sehr viel fotografiert. Bleibt für deine eigene Arbeit auch noch Zeit?
Ursprünglich komme ich aus der Bildenden Kunst, wie schon anfangs erwähnt. Ich habe vor längerer Zeit aufgehört, künstlerisch tätig zu sein, und mich seitdem der Administration, dem Netzwerken in der Kunst und Fotografie gewidmet und begreife das als mein Tätigkeitsfeld. Ich fotografiere natürlich selbst noch gerne – inzwischen eher auf meinem Handy.
Durch das Netzwerken manifestierst du neue Situationen und bringst Menschen zusammen. Das ist ein ganz großer Akt des Gestaltens.
Ich bin mit der Arbeit als Bildredakteur sehr glücklich. Und ich sehe in der Arbeit als Netzwerker eine erfüllendere Arbeit für mich als in der Position des Bildproduzenten. Das Entstehen von Lösungen für visuelle Fragestellungen ist eine sehr interessante Aufgabe – verschiedene Gewerke kommen zusammen und aus der Synergie ergibt sich etwas ganz Neues und Kraftvolles und Unerwartetes.
Welche Fotografen und Fotografinnen inspirieren dich aktuell?
Ich habe eher Steckenpferde und Themen, die mich inspirieren und über Bilder nachdenken lassen. Der Umgang mit dem menschlichen Portrait gehört sicherlich dazu. Menschen abzubilden ist ein für mich sehr interessantes Thema. Ich schaue mir sehr gern Portraits an und überlege, wie die Situation zwischen dem Fotografierenden und dem Fotografierten wohl gewesen sein muss, damit dieses Bild entsteht. Welche Voraussetzungen bringen beide mit in die Kommunikation, und wie spiegeln sich diese im Bild – welche Voraussetzungen bringe ich als Betrachter mit, und wie manifestieren sich diese im Dialog mit dem Bild. Ein gutes Portrait erzählt mir auch sehr viel über mich selbst.
Wir hatten am Anfang unseres Interviews kurz über das gute Bild gesprochen. Möchtest du noch etwas über dieses gute Bild erzählen, und welche anderen Komponenten es beinhalten soll?
Ein interessantes Bild macht sicherlich aus, mutig an die Grenzen der Wahrnehmung, der fotografischen Ästhetik oder des fotografischen Kanons vorzustoßen. Ich kann nur dazu anregen, Umsetzungen anzustreben, die nicht in den ästhetischen oder inhaltlichen Kanon passen, um damit neue Räume zu erschliessen. Ein interessantes Bild löst in mir eine Art visuellen Kurzschluss aus…
…und geht damit eine Abkürzung. Es ist ein Enzym – ein Katalysator.
Genau, diese katalytische Funktion eines Bildes ist für mich eine schöne Metapher. Wenn das Bild zwischen Wahrnehmung, zwischen Gedanke und Gefühl irgendwo in der Mitte als Katalysator stehen darf, dann ist das ganz wunderbar. Es gibt Bilder, die das sehr subtil und sehr sensibel bewerkstelligen. Dort ist für mich das interessante Bild verortet. Ob das ein Porträt ist oder eine urbane Aufnahme, ist in dieser Diskussion nicht so wichtig – das zeigt vielleicht eines der grundsätzlichsten Aspekte eines interessanten Bildes auf – es muss mich berühren. Und das tut es über seine katalytische Wirkung. Eine starke Wirkung kann es auch durch das Zusammenspiel verschiedener Deutungsebenen hervorrufen, die auf einmal Funken in meinem Kopf entstehen lassen und Assoziationsketten auslösen. Das hat für mich sehr viel mit gestalterischer Freiheit zu tun. Es ist ein offener Raum, in dem man sich positioniert und neu aufstellen kann, in dem man die Welt aus verschiedenen Perspektiven betrachtet.
Interview: Nadine Ethner, Oktober 2020
© all images by the artists and photographers / Tobias Laukemper Büro für Bild und Struktur